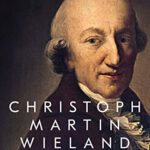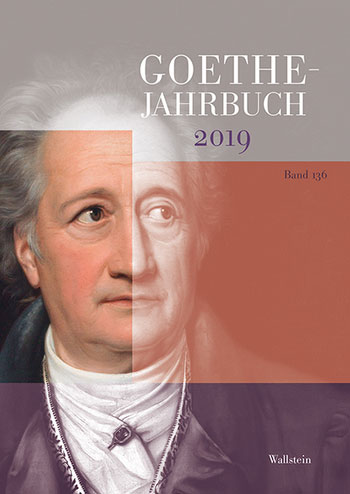Blog
Schiller und die „Einhegung der Frau“ – Band 3 der Schiller-Studien widmet sich der „Jungfrau von Orleans“
Als drittem Band seiner Reihe „Schiller-Studien“ hat der Schillerverein Weimar-Jena sich jetzt nach „Schillers Krankheiten – Pathographie und Pathopoetik“ (Band 1) und „Freiheit im Werden? – Schillers Vorlesungen an der Universität Jena“ (Band 2) einem konkreten Werk zugewandt: „Friedrich Schillers Tragödie ‚Die Jungfrau von Orleans‘ (1801)“. In gebundener Form setzt der Verein damit eine Publikationen-Tradition fort, mit der er seit seiner Gründung am 10. November 1991, dem 232. Geburtstag von Friedrich Schiller, als juristisch selbstständiger Tochterverein der in Marbach am Neckar beheimateten Deutschen Schillergesellschaft sehr erfolgreich ist. Nun also ist der Fokus auf ein einzelnes Drama gerichtet, das unter verschiedenen Fragen betrachtet wird.
Erstaunlich ist bereits auf den ersten Blick, wie vielfältig und ergiebig sich mögliche Zugänge zu einem Stück gewinnen lassen, das vor mehr als 200 Jahren erstmals veröffentlicht wurde und damals bereits historische Vorgänge behandelte. Offenbar hat es wenig von seiner Aktualität verloren, schwankt Johannas Charakterbild in der Geschichte, authentisch oder als gestaltete Kunstfigur, belebt jedenfalls durch unterschiedliche Narrative und Betrachtungs-Ansätze. Gleich eingangs weist Helmut Hühn als einer der Herausgeber des Bandes – neben Nikolas Immer und Ariane Ludwig – darauf hin, dass die „Irritations- und Provokationspotentiale“ dieser „romantischen Tragödie“ auch mehr als 200 Jahre nach ihrer Uraufführung 1801 in Leipzig noch unvermindert funktionieren und Rätsel aufgeben (S. 7).
Das belegen die Beiträger auf unterschiedliche Weise. So untersucht Claudia Benthien „‚Fremder Ketten Schmach‘ Zur Dynamik von Scham und Schuld in Schillers ‚romantischer Tragödie‘“ (S. 27–62). Im Vordergrund steht für sie zunächst die zeitliche Distanz zwischen der Erstpublikation in Berlin 1801 und der historischen Handlung „im frühen 15. Jahrhundert in Frankreich.“ Nicht zuletzt „aus der Verknüpfung dieser Zeiträume“ ergebe sich eine Spannung, sie verbinde das Modell einer „mittelalterlichen Schamkultur“ mit einer „neuzeitlichen ‚Schuldkultur‘“ (S. 27). Schiller habe sich „an Kants juristischem Vokabular“ orientiert, um „den finalen Triumph der Gerechtigkeit zu markieren“ (S. 50). Dabei spiele er mit Motiven des Christentums: „Die Apotheose der Johanna von Orleans ist an die Ikonographie der Himmelfahrt Mariae angelehnt“ (S. 51). Johanna figuriere dabei „als Opfer und als Allegorie der Versöhnung“ (S. 52).
Während bei Claudia Benthien der ideelle Rahmen eine zentrale Rolle spielt, nimmt Ulrich Port reale Machtkämpfe und deren ideologische Überhöhung ins Visier: „Johanna als Blutzeugin – Schillers ‚Jungfrau von Orleans‘ und die politische Konjunktur der Martyriumsidee in den 1790er Jahren“ (S. 63–91). An Hand von Beispielen belegt er, dass „sowohl hinsichtlich der leitenden Kontrast-Vorstellung wie der gewählten Begrifflichkeit“ Johannas letzter Vers „Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude“ dem „Formelbestand christlicher Martyriums-Ideen“ entstamme (S. 64). „‚Heiligkeit‘, ‚Opferbereitschaft‘ und ‚Martyrium‘ im strikt theologisch-kanonischen Sinne werden transformiert in ein idealistisches und patriotisch getöntes Charisma, das in der Zeit der Napoleonischen Kriege sowohl für die ‚niederen Stände‘ mit ihren popularreligiösen Bedürfnissen wie für die ‚Gebildeten unter den Verächtern‘ der Religion einen kulturellen und politischen Identifikationswert besitzen soll. Ebendas unterscheidet Johannas vaterländisch politisiertes Martyrium auch vom frühchristlichen Modell, wo ein Sterben ‚pro patria‘, wie es Horaz, Cicero und andere römische Autoren gefeiert haben, gegenüber dem Sterben für Gott, Christus und den wahren Glauben zu den minder wertvollen Spielarten ‚in contemptu mortis‘ (der Todesverachtung) gehören“ (S. 86).
Modern betrachtet aus der Perspektive „einer westeuropäisch-postheroischen Gesellschaft“ (S. 86), mute „dieses ganze Religionseifer- und Martyriums-Syndrom der Revolutionszeit inklusive seiner literarischen Verhandlung in Schillers Jungfrau wie ein unheimlicher Wiedergänger an, ein Revenant aus der Zeit der Kreuzzüge oder der Konfessionskriege des 16./17. Jahrhunderts. Doch wenn der russische Ultranationalist Alexander Dugin ein halbes Jahr nach Beginn des Überfalls Russlands auf die Ukraine und nach dem Tod seiner Tochter Darja bei einem Bombenanschlag im August 2022 erklärt, seine Tochter habe ihr ‚jungfräuliches Leben‘ auf dem ‚Altar‘ des Sieges Russlands geopfert und solle ‚die Söhne unseres Vaterlandes zu Heldentaten inspirieren‘, zeigt sich, dass es zur Zeit Schillers nicht das letzte Mal gewesen ist, dass dieser Revenant Gesellschaften heimgesucht hat“ (S. 87).
Recht unorthodox greift Antonia Eder den Klassiker auf: „Glaube, Liebe, Räume, Geschlechtertopologie und Raumsemantik in Schillers ‚Die Jungfrau von Orleans‘“ (S. 93–127). „Raumverhältnisse in der Literatur“ seien nicht nur ein „dekorativer Hintergrund“, sondern „sowohl auf intratextueller als auch auf der Rezeptionsebene semantisch wirksam“ (S. 93). Auf den ersten Blick mag diese Idee irritieren, bietet aber ungewohnte Einblicke in den Text. Orientiert an Überlegungen von Claudia Honneggers „Ordnung der Geschlechter“ weist Antonia Eder darauf hin, dass hier spezifische Rollenmuster wichtig werden: „Über die ‚Erfindung‘ der Naturalisierung von Männlichkeit und Weiblichkeit, d.h. eine mögliche Ableitung von sozialen, emotionalen oder intellektuellen Fähigkeiten und damit auch Zuständigkeiten qua Geschlecht, wird ein wichtiges Instrument zur politischen sowie ökonomischen Ausgrenzung und damit Einhegung der Frau im 18. Jahrhundert gewonnen“ (S. 96).
Diese unfairen Bedingungen stelle Schiller in Frage. Seine Heldin werde „als metaphysisch überformte Weiblichkeit in den vertikalen Raum eingetragen“ (S. 100). Schiller spiele damit im Raum der Bühne, um Machtverhältnisse und Klischees zu negieren. „Johannas fluides Geschlechtermodell sprengt machtvoll die herkömmlichen Kategorien: Sie ist die ‚männlich-weibliche Jungfrau-Kriegerin, Göttin-Teufelserscheinung. Muttergottes-Hure‘ und damit bedrohlich genug, um final in ein Frauenbild gebannt zu werden, das patriarchale Strukturen ebenso bestätigt wie stabilisiert: die Heilige“ (S. 100).
Letztlich appelliert diese ausgefallene Deutung auch an die Bereitschaft, sich auf eine neue und originelle Lesart einzulassen. Deshalb sei hier noch ein längeres Beispiel dieser Argumentation zitiert: „Der Körper der weiblichen Heldin sinkt nieder und Johanna liegt am Ende des Dramas auf dem Bühnenboden: In der Ebene der Horizontale, im Raum der geschichtlichen Gegenwart ist sie entmachtet. Erhoben wird sie gleichwohl allegorisch, zunächst über ihren wunderbaren Flug vom Turm hinab aufs Schlachtfeld und dann phantasmagorisch wieder hinauf in den Himmel und letztlich zur Nationalheiligen. Den Aufstieg und Fall der Heldin und ihres Körpers organisiert im Drama eine dramatische Vertikale: Zunächst als göttlich ausgezeichnet, verliert Johanna über lapsarische Dynamiken ihre souveräne Position im Bühnenraum, wird aber final zur Nationalheiligen erhoben und geradezu überhöht. Hier findet sich eine symptomatische Konfiguration von Weiblichkeit, in der die Frau aus dem Horizont der Geschichte buchstäblich herausfällt, um in der Vertikale als personifiziertes Reinheitssymbol oder als allegorisches Sinnbild zu fungieren. Dies erzeugt zugleich die körperpolitische Einhegung und Entsexualisierung der Frau, die von nun an eben auch nur noch Heilige sein darf“ (S. 117). Über ihren „geschlechtertopologischen Code“ evoziere „Schillers ‚romantische Tragödie‘ so durchaus lustvoll Brüche in der von ihr bespielten Raum-Zeit“ (S. 120). Pointiert gesagt: Schiller führt mit seiner bildhaften Bühnen-Sprache die „Einhegung der Frau“ ad absurdum.
Den Band rundet eine historisch gleichermaßen wichtige und hilfreiche Erinnerung von Jochen Golz ab, er berichtet als aktiver Zeitzeuge „Von der Gründung des Weimarer Schillervereins“ (S. 129–147) anlässlich des „dreißigjährigen“ Jubiläums von dessen Anfängen, die er seinerzeit selbst maßgeblich zu gestalten vermochte. Auch als langjähriger Präsident der Goethe-Gesellschaft kennt er die Geschichte beider Organisationen, wie wohl nur wenige andere Beteiligte. Nach dem Krieg beobachteten die Alliierten „in der Zeit des Faschismus existierende Vereine“ (S. 130) mit Misstrauen, zunächst wurde auch die 1885 gegründete Goethe-Gesellschaft in Weimar verboten, bald konnte sie jedoch ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. Allerdings war der 1895 gegründete Schwäbische Schillerverein in Marbach und damit in der Bundesrepublik beheimatet, das stellte die Ost-Berliner Behörden vor ein Problem. Seine Arbeit und Publikationen wollte man in der DDR nicht ohne eigenen Einfluss zulassen. So wurde 1970 der Zentrale Arbeitskreis Friedrich Schiller im Deutschen Kulturbund gegründet, aus dem 1991 der Weimarer Schillerverein hervorging. Dass diese Entwicklung als Erfolgsgeschichte verbucht werden darf, nicht zuletzt auch dank der Kenntnisse und des Engagements von Jochen Golz, belegt einmal mehr der nun vorliegende dritte Band der „Schiller-Studien“ von 2023. Auf die folgenden darf man gespannt sein.

Helmut Hühn / Nikolas Immer / Ariane Ludwig (Hrsg.)
Friedrich Schillers Tragödie ‚Die Jungfrau von Orleans‘ (1801). Lektüren
Hannover 2023
160 Seiten, mit 9 Abbildungen
ISBN 978-3-98859-033-6
Preis: 18,00 €