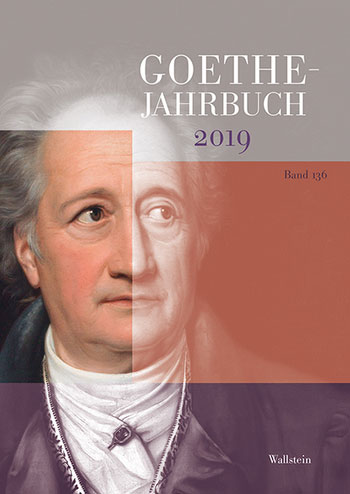Blog
Anmutig unterhalten? Anmerkungen zu einem Buch von Dieter Strauss
Ein in mehrfacher Hinsicht merkwürdiges Buch ist anzuzeigen. Unter dem tagesjournalistisch beliebten Titel „Beinahe beste Freunde“ ist ein „biografischer Roman“ erschienen, in dem die Beziehungen zwischen Alexander von Humboldt und Goethe nachgezeichnet werden. Was ist ein biografischer Roman oder, wie der Autor vom Dichter entlehnt hat, ein „Halbroman“ (S. 8)? Bei Lichte betrachtet, handelt es sich um eine Mischung aus chronikalischer Rekonstruktion von Lebenskonstellationen und erzählenden Passagen, deren Dialog- oder Gesprächspartien seltsamerweise durch Kommandostriche von den dokumentarischen Teilen separiert sind.
Der hier erhobene Anspruch ist kein geringer. „Das ‚was‘, so auf S. 7 formuliert, „ist also wahr, nur das ‚wie‘, die literarische Form, stammt vom Autor. Ob das angeschnittene Thema in einen Dialog, in einen inneren Monolog, in einen Brief oder in einen Bericht gegossen wird, hängt vom Erzähler ab. Dabei entspricht selbst die Chronologie der Ereignisse der Realität. Das jeweils angesprochene Problem wurde von den Protagonisten zu dem angegebenen Zeitpunkt wirklich so gesehen.“
Sehen wir, diese Bekundung möglichst beim Wort nehmend, genauer hin. Eine Reihe von Jahren war Strauss an wechselnden Stationen im Dienst des Goethe-Instituts in Südamerika tätig. Was er an eigenen Beobachtungen und aus historischen Berichten über Humboldts Reisen mitteilt, möchte ich, ohne es selbst an den Quellen nachgeprüft zu haben, für zutreffend halten. Anders ist es um die historische Wahrheit bestellt, wenn wir uns Goethes Biographie und in solchem Zusammenhang etwa seiner Altersliebe zu Ulrike von Levetzow zuwenden. Hier wärmt Strauss die Legende auf, dass Carl August den Brautwerber für Goethe gespielt habe, behauptet, dass sich Goethes Enkel über seine erotischen Eskapaden „mokiert“ (S. 90) hätten; Goethes ältester Enkel war damals gerade einmal fünf Jahre alt. Auch spricht der Autor unreflektiert von den „Marienbader Elegien“, ohne zu bedenken, dass die drei als „Trilogie der Leidenschaft“ in der Ausgabe letzter Hand veröffentlichten Gedichte jeweils anderen Zusammenhängen entsprungen sind. Das erste entstand aufgrund einer Bitte des „Werther“-Verlegers Weygand, einen Beitrag zu einer Jubiläumsausgabe des Jugendromans zu liefern, das dritte ist für die polnische Pianistin Maria Szymanowska geschrieben worden; lediglich die mittlere „Elegie“ ist unmittelbar nach der Abreise aus Marienbad im ersten Entwurf aufgezeichnet worden. Großzügig geht der Autor auch mit anderen Goethe-Legenden um. Die durch nichts bezeugten angeblich letzten Worte „Mehr Licht“ dienen ihm als Motiv für eine Altersreflexion, die eine bedenkliche Nähe zu belletristischem Kitsch aufweist. Oberflächlich fallen auch Urteile über poetische Werke aus. „Herrmann und Dorothea“ sei eine „romantische Liebesstory in Revolutionszeiten“ (S. 21), in Goethes Gedicht „Gingo Biloba“ wird der Baum zu einem „Symbol der Freundschaft“ (S. 12). Eine vollständige Liste der Irrtümer (und Druckfehler), die teils dem Autor, teils einem Korrektor – wenn es denn einen solchen gegeben hat – anzulasten sind, wäre von beträchtlichem Umfang. Biographische Wahrheit? Fehlanzeige.
Nun wird Strauss geneigt sein, solche Kritik als unerheblich abzutun, als lässliche Sünde, über die man angesichts der sonst verhandelten bedeutenden Problematik schon einmal hinwegsehen könne. Wahr soll also auch sein – vermutlich in einem vom Autor intendierten ‚höheren‘ Sinn –, dass sich Humboldt und Goethe über die Schlussszenen von „Faust II“ unterhalten hätten. Wenn man weiß, dass Goethe es selbst gegenüber seinen wirklichen Altersfreunden Wilhelm von Humboldt und Zelter vermieden hat, sich nur ein Wort über den „Faust“ entlocken zu lassen – lediglich in seinem letzten Brief an Wilhelm von Humboldt wird auf den „Faust“ abwehrend Bezug genommen –, mutet es absurd an, dass Strauss dem greisen Goethe eine Exegese der Schlussszenen in den Mund legt, auf die Humboldt dann im Kommandostrichverfahren repliziert. Was aus dieser Exegese spricht, ist vor allem das sehr begrenzte Verständnis des Autors für Goethes Dichtung; so kann man nur über „Faust II“ schreiben, wenn man blind ist gegenüber dem Stand der Goethe-Forschung. An anderer Stelle (S. 99) wird ein Gespräch im Haus am Frauenplan über den Helena-Akt erfunden, den der Autor zuvor vorgetragen haben soll; in dessen Verlauf fragt einer der Teilnehmer nach der Rolle des Homunculus, ein anderer nimmt Bezug auf eine (im Übrigen falsch wiedergegebene) Aussage der Manto. Strauss scheint vergessen zu haben, dass Homunculus und Manto zwar in der Klassischen Walpurgisnacht, nicht aber im Helena-Akt vorkommen. Auch hier ist schlichtweg zu leugnen, dass das „jeweils angesprochene Problem […] von den Protagonisten zu dem angegebenen Zeitpunkt wirklich so gesehen“ werden konnte.
Damit berühren wir ein generelles Problem, das Verhältnis von biografischer Dokumentation und literarischer Fiktion, das sich in dieser Publikation in einem besonderen Missstand befindet. Lassen schon die bereits benannten Unrichtigkeiten in den Goethe-Passagen Misstrauen gegenüber dem Ganzen aufkommen, so wird dieses Misstrauen noch geschürt, wenn man der Behauptung des Autors nachgeht, dass „die Chronologie der Ereignisse der Realität“ entspreche. An nicht wenigen Stellen wird offengelassen, wann und wo die fiktiven Passagen einzuordnen sind. Dass mit der Chronologie großzügig umgesprungen wird, mag man bei einem Roman konzedieren; bei einem Autor, der auf historischer Wahrheit auch in der Fiktion besteht, dürfte das schon schwieriger zu rechtfertigen sein. Was Goethe in den Mund gelegt wird (nur dazu kann ich mich äußern), erweist sich als eine mehr oder minder gelungene Montage aus Zitaten, die Briefen oder Werken entnommen sind. Aber ist es erlaubt, Goethe im Dialog mit Humboldt (S. 101 unten) einen Satz sprechen zu lassen, der einem Brief an Zelter entnommen ist, oder ihm (S. 40) einen Satz in den Mund zu legen, der aus einem Brief Schillers an Körner stammt; ist es erlaubt, im Dienst einer ‚höheren‘ Wahrheit Briefe von Humboldt und Goethe einfach zu erfinden, sie an einigen Stellen durch Anführungszeichen sogar als authentische Zitate auszuweisen? Ich denke nicht. Um ein Beispiel zu geben: Der Text, der auf S. 76 als Brief Humboldts an Goethe vom 3. Januar 1810 durch Anführungszeichen als authentisch präsentiert wird, ist eine freie Erfindung des Autors, in die nur wenige originale Brocken übernommen worden sind; hier würde ich von Fälschung sprechen.
Das alles kennzeichnet ein Verfahren, dem möglicherweise eine Ursprungsintention des Autors zugrunde liegt. Für ihn erweist sich Humboldt als prophetischer Vordenker der „Globalisierung“ (S. 14), stellen sich Humboldt und Goethe als Persönlichkeiten dar, die bereits aufmerksam waren für die „menschengemachten Umwelt- und Klimaschäden“, für die „Gefahren der anthropozentrischen Weltsicht“ (S. 134). Humboldt, so des fiktiven Goethes Diktum „könne sich […] wirklich als Vater des Umweltschutzes verstehen“ (S. 49). Gegen Ende des Buches, wo aus der Perspektive beider Diskutanten so etwas wie eine Bilanz versucht wird, heißt es in schönster kulturwissenschaftlicher Prosa, „in ihrer Forderung nach ganzheitlicher internationaler Verknüpfung der Natur- und Kulturwissenschaften“ seien sie sich „völlig einig“ gewesen (S. 126). Goethe, überflüssig zu erwähnen, hat Begriffe wie Umweltschutz oder Kulturwissenschaften – wie auch andere aktuelle Vokabeln, die ihm bei Strauss zugewiesen werden – nicht in den Mund nehmen können. Großzügig wird hier übergangen, dass selbst genialen Naturen wie Humboldt und Goethe Grenzen der historischen Erkenntnis auferlegt waren, die es verbieten, sie schlankweg für die Ziele heutiger Umweltpolitik in Dienst zu nehmen. Dass „nur Tatsachen in der gewählten fiktiven Form“ stecken (S. 7), ist eine durch nichts gedeckte Behauptung.
Ein Wort noch zur „fiktiven Form“: Was die Dialogpartien charakterisiert, ist ihre Nähe zu einem aufdringlichen Journalismus. Die zusammenmontierten Aussagen werden häufig beschlossen durch Verbformen wie griente, grinste, feixte, kicherte, lächelte, schmunzelte, schäkerte, scherzte, stöhnte, seufzte, ulkte oder blödelte – ein triviales Verfahren, Aussage und Stimmungsgehalt in ein Wort zu pressen. Es blödeln z.B. Goethe, seine Ehefrau Christiane und Humboldts Reisegefährte Bonpland, während Humboldt grinst oder feixt und Goethe zuweilen „in sich hinein kichert“ (S. 82). Überhaupt hält heutiger Alltagsjargon Einzug in die Fiktion. Goethe „tigerte […] durch sein Arbeitszimmer“ (S. 47), Humboldt „lud […] nach“ (S. 114) – untaugliche Versuche, uns beide Persönlichkeiten ‚menschlich‘ näherzubringen. Da werden Anspielungen auf Humboldts Homosexualität („eine seiner üblichen Männergeschichten“, S. 44) ebenso wenig vermieden wie in ihrer Häufigkeit unangebrachte und zudem geschmacklose Erwähnungen von Goethes Korpulenz („Goethe strich sich behaglich über seinen stattlichen Bauch, den Bekannte bereits nicht ganz zu Unrecht mit den Rundungen einer Hochschwangeren verglichen hatten“, weiter unten nickt er „mit wabbeligem Doppelkinn“, beides S. 14). Semantische Differenzierung ist viel zu selten anzutreffen; es ist von „interkulturellen Unterschieden“ (S. 51) die Rede, wo es sich doch um kulturelle Unterschiede handelt. Ein Satz sei noch zitiert, der gegen Ende des Buches das Fragwürdige des Verfahrens noch einmal ins Licht rückt: „‘Wie herrlich diese Strahlen, sie scheinen die Erde zum Himmel zu rufen‘, lauteten exakt die letzten Worte Humboldts, die ihn sofort an Goethes ‚Mehr Licht‘ erinnerten.“ (S. 133) Humboldt kann Goethes sogenannte letzte Worte niemals zur Kenntnis genommen und sie darum auch nicht in der Erinnerung bewahrt haben. Was ist hier Wahrheit?
Im letzten Abschnitt des Buches, „Literaturangaben und Lesetipps“ überschrieben, deklariert Strauss noch einmal selbstbewusst seine Motivation, „dieses Buch als biografischen Roman“ geschrieben zu haben, „der richtig informieren und gleichzeitig unterhalten will. Etwa so wie Daniel Kehlmann in seiner ‚Vermessung der Welt‘ oder wie Goethe in ‚Dichtung und Wahrheit‘, nur liegt bei mir der Akzent noch stärker auf der ‚Wahrheit‘. (S. 137 f.) Die Vermessenheit dieses Satzes scheint dem Autor gar nicht bewusst geworden zu sein. Gegenüber Kehlmanns intellektueller wie stilistischer Brillanz erscheint des Autors Versuch bestenfalls als journalistische Fingerübung, und ein Vergleich mit Goethes Buch verbietet sich von selbst. Thomas Mann hat im 7. Kapitel seiner „Lotte in Weimar“ einen aus Zitaten gewobenen inneren Monolog Goethes gestaltet, in dem auf hochironische Weise Authentisches und Fiktives verbunden sind. Von solcher literarischen Meisterschaft ist Strauss weit entfernt. Richtig informieren, um das Postulat des Autors aufzugreifen, konnte ich mich anhand meiner Lektüre nicht, am Unterhaltungswert des Dargestellten muss ich starke Abstriche machen. In meiner Rezension von Straussens Buch „Goethes Wanderjahre in Lateinamerika und der Südsee“ (Goethe-Jahrbuch 2015, S. 253-255) habe ich Untugenden dieser Publikation benannt, die im Vorliegenden noch gesteigert worden sind. Summa summarum: Ein entbehrliches Buch, dessen Datei besser hätte ungedruckt bleiben sollen.

Dieter Strauss
Beinahe beste Freunde. Alexander von Humboldt und Johann Wolfgang von Goethe
Verlag Peter Lang, Berlin u.a. 2021
143 S.
ISBN: 978-3-631-83426-8
Preis: 24,95 €
Dieser Artikel erschien zuerst im Newsletter der Goethe-Gesellschaft, Ausgabe 3/2021.