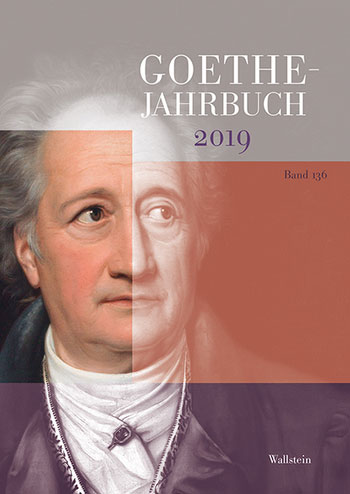Blog
„Werther“ im Kaleidoskop – Essays zum Erscheinen vor 250 Jahren
Aufsehen erregte auf der Leipziger Herbstmesse 1774 und bald darauf überall in Europa ein schmaler Band mit dem Titel „Die Leiden des jungen Werthers“. Ohne eine Bezeichnung der Gattung erschien er oder den Namen des Verfassers zu nennen. Rasant entwickelte sich das Buch zu einem internationalen Beststeller, auch dank einiger Raubdrucke. Doch warum erregte speziell diese Publikation solche Aufmerksamkeit? „Es sind lauter Brandraketen!“, sagte Goethe Jahre danach, so jedenfalls überliefert es Eckermann.
In Briefen erscheint ein Selbstmörder als liebenswert, als tragische Figur – für die Kirche ein Tabu-Bruch. Und der Autor äußert Kritik am Feudalismus: Das traf den Nerv der Zeit. Das Buch löste ein „Werther-Fieber“ aus bis hin zur Mode, einen schier unübersehbaren Reigen an Echos: Verboten wurde der Roman und angefeindet, aber auch vehement verteidigt und gefeiert oder karikiert und vor allem: wegen des Erfolgs auf verschiedene Weise kopiert. „Wertheriaden“ mehr oder weniger eng angelehnt erschienen auf dem Markt: Parodien, Imitationen, Erweiterungen, Fortschreibungen, Gedichte und Bänkellieder, Bühnenversionen und Opern entstanden und Verfilmungen. Diese einzigartige Wirkung dauert bis heute an.
Grund genug also, anlässlich des Jubiläums von Goethes erfolgreichstem Werk für Frieder von Ammon und Alexander Košenina, einen Band herauszugeben: „250 Jahre ‚Werther‘“. Die Autoren der Beiträge erläutern diesen Geniestreich des jungen Goethe und seinen Erfolg aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und nehmen sich der anhaltenden Wellen an, die er geschlagen hat. Man glaubt es kaum, was sich alles aus diesem fiktiven Schicksal entwickelt hat.
Goethes „Werther“ unterscheide von anderer Literatur seiner Zeit, darauf weisen die Herausgeber gleich eingangs in ihrer „Vorbemerkung“ (S. 7–10) hin, dass der Roman „sich auch heute noch mühelos lesen“ lasse, er erschließe „sich gleichsam wie von selbst, ohne dass man dabei die Hilfestellungen der Literaturwissenschaft in Anspruch nehmen müsste“ (S. 7). Zwar gibt es jede Menge Kommentare und Lesehilfen, doch der Text ist ohne Handreichungen verständlich. Daraus könnte man schließen, dass weitere Darstellungen überflüssig wären. Das nun wieder auch nicht. Denn diese Essays stellen den Text in seinen literarhistorischen Zusammenhang und erleichtern, ihn in seiner inhaltlichen Substanz, ästhetischen Fülle und Schönheit besser zu erkennen, auszukosten und zu genießen.
Realismus und Erzähltechniken
Astrid Dröse fragt in ihrem Aufsatz „Werthers Welten“ nach dem „Realismus im Roman des jungen Goethe“ (S. 11–28). Dabei interessiert sie „nicht primär“ der „inhaltliche Realismus“, nicht „die Frage nach Faktenfragmenten“, sondern der „Realismus als Darstellungsweise, als ästhetische Strategie und Haltung“ (S. 15). Sie unterscheidet „drei Spielarten des Realismus“: den „dokumentarischen“, den „psychologischen“ und drittens einen, der durch speziell angewandte „Erzähltechniken“, auf „Realitätseffekte“ setzt (S.16). Auch beschriebene Requisiten und Accessoires dienen als Realia der Darstellung wie ein „Cabinetgen“: ein Gartenhäuschen (S. 24). Freilich könne die Realität ins Abstrakte umschlagen, wenn Werther sich in „Textwelten“ bewegt, seine eigne Ossian-Übersetzung vorträgt und die Natur „starr“ vor ihm erlebt: „wie ein lackiert Bildgen“ (S. 25).
Mit dem Zitat aus der Einleitung des fiktiven Herausgebers „Lass das Büchlein deinen Freund sein“ (S. 29) überschreibt Alexander Košenina seine Überlegungen „‚Ichzeit‘ in Goethes ‚Werther‘ (1774) und Willers Trauerspiel ‚Werther‘ (1778)“ (S. 29–42). Viel und häufig wurde darüber spekuliert, was an der Handlung des „Werther“ echte Krankengeschichte sei und, dass Goethe „durch Werther in eigener Sache“ spreche (S. 32). Subjektive Erlebnisse des Autors und authentische Ereignisse zur Beglaubigung des literarischen Geschehens als dokumentarische Collage, etwa wenn Goethe Kestners Bericht in den Roman montierte, animierten Leser, nach historischen Vorbildern zu suchen. Auch wenn diese literarische „Ichzeit“ als neue Form des Erzählens von manchen zeitgenössischen Autoren in Anspruch genommen werde, sei „radikale Subjektivität und Ichverliebtheit“ (S. 42) bereits ein zentrales Prinzip des „Sturm und Drang“ und eben keine Erfindung der Moderne, argumentiert Alexander Košenina.
Auf die Fährte eines weiblichen Pendants von Goethes tragischem Helden begibt sich Anna Axtner-Borsutzky: „Ein ‚weiblicher Werther‘? Neue Perspektiven auf Sophie von La Roches ‚Rosalie‘ und die Entstehungsgeschichte des ‚Werther‘“ (S. 43–57). J. M. R. Lenz brachte ihn – einen „weiblichen Werther“ – ins Gespräch, ohne Hinweis darauf, wo diese Heldin genau zu finden sei, nachdem er Sophie von La Roches Briefroman gelesen hatte. Dort taucht in einigen Briefen eine Figur auf, Henriette von Effen, die in der Tat Ähnlichkeiten mit Werther aufweist, allerdings auch deutliche Unterschiede: „Eine mit zahlreichen Superlativen besonders hervorgehobene Figur geht an ihrer Melancholie zugrunde“ (S. 56). Das Schicksal eines Helden, der daran zerbricht, dass er seine Identität nicht angemessen ausleben kann und stattdessen versucht, gesellschaftlichen Klischees und Stereotypen zu genügen, ließ sich freilich auch auf andere gesellschaftliche Gruppen übertragen.
Modell: Außenseiter
In seinem Beitrag „‚Durch Stoff und Stimmung (…) gerechtfertigt‘ Goethes ‚Werther in der Homosexuellenbewegung um 1900“ (S. 107–119) untersucht Moritz Strohschneider den „Tagebuchroman“ eines unbekannten Autors, unter dem Pseudonym „Narkissos“ veröffentlichte er 1902 seine Version „Der neue Werther“ (S. 108). Strohschneider vergleicht Goethes Vorlage mit dieser neuen, ganz anders gearteten Leidensgeschichte: „Weil er Männer also nicht lieben darf, anders aber nicht leben will, erscheint dem Protagonisten der Tod als einziger Ausweg“ (S. 117). Dabei weist Strohschneider noch auf einen anderes Außenseiterschicksal in der Tradition Werthers hin: Bereits 1892 hatte Ludwig Jacobowski „das tragische Schicksal des jungen Leo Wolff, dem es als Juden unmöglich gemacht wird, sich in die Gesellschaft einzufügen“ unter dem Titel „Werther, der Jude“ erzählt (S. 119). Werthers „Krankheit zum Tode“ wird als Leiden und Scheitern an den Zwängen einer inhumanen Gesellschaft gelesen. Die Krankheitsgeschichte avanciert zum Modellfall sozialen Außenseitertums.
Wie weit die Wellen des „Werther-Fiebers“ die kulturelle Welt beleben konnten und können, nicht zuletzt dadurch, dass sie aktuelle Bezüge ihrer Region aufgreifen, belegen auch die drei Essays von Franziska Meier: „Werther in Italien. Zur Begründung des Selbstmordes in Ugo Foscolos Briefroman ‚Le Ultime lettere di Jacopo Ortis (1802)“ (S. 59–76), Annette Antoine: „‚Werther‘ in Wien. Joseph Ferdinand Kringsteiners kritische Lokalposse ‚Werthers Leiden‘ auf dem Wiener Vorstadttheater“ (S. 77–91) – immerhin erblickten an der Donau „gleich sechs Wiener Parodien zum ‚Werther‘ (…) bis 1850“ (S. 84–85) das Licht der Bühnen – und Cord-Friedrich Berghahn. Der richtet den Blick nach Paris: ‚„Ce triste sujet …‘. Jules Massenets ‚Werther‘ und die musikalische Moderne nach Wagner“ (S. 93–106).
Laterna Magica und Leinwand
„‚Die Leiden des jungen Werthers‘ in ihren Verfilmungen“ (S. 121–135) untersucht Timm Reimers und folgt damit direkt den Spuren des tragischen Helden, der bereits im fiktiven Brief vom 18. Juli beschreibt, was eine „Zauberlaterne“, die Laterna Magica, an Illusionen zu leisten vermag: „Kaum bringst Du das Lämpgen hinein, so scheinen Dir die buntesten Bilder an Deine weiße Wand!“ (S. 121). Interessant liest sich, wie die Regisseure Max Ophüls 1938 im Exil und Egon Günther 1976 in der DDR die klassische Vorlage nutzen, um ihrer jeweiligen politischen Situation mehr oder weniger behutsam Paroli zu bieten. Leider ist die erste (stumm-)filmische Adaption von Henri Pouctal in Frankreich von 1910 verschollen, aber Reimers verfolgt diese Tradition über alle relevanten Entwicklungen bis hin zu modernen Beispielen, die teilweise mit Goethe Werk kaum mehr als den verkaufsträchtigen Titel gemein haben.
Originell ist der Ansatz, Bibliotheken von Schriftstellern daraufhin zu untersuchen, ob sie „Werther“-Ausgaben enthielten und ihre Besitzer darin vielleicht sogar Notizen hinterließen. Ihm folgt Constanze Baum: „Werther-Spuren. Exemplargeschichten aus den Archiven der Gegenwart“ (S. 137–157). Dazu hat sie die Nachlässe u. a. von Bert Brecht, Anna Seghers oder Christoph Schlingensief untersucht. Leider ist sie dabei mit dem Problem konfrontiert, dass deren Überlieferung Zufällen unterliegt. So besaß Brecht ein bibliophiles Exemplar von 1775, das „im Findbuch noch nachgewiesen wird, aber bedauerlicherweise als Verlust zu verzeichnen ist“ (S. 143). Ein recht weites Verständnis von Medien liegt dem Aufsatz von Birgit Tautz zugrunde: „‚Werthers‘ Medien“ (S. 159–170). Sie postuliert, der Roman sei „voll von ihnen: den Dingen, Lebewesen und Charakteren, die etwas im Zuge der Handlung vermitteln und als Medium fungieren“ (S. 159). Deshalb sei allerdings der Roman „nicht mehr lesbar als solcher. Was bleibt, ist die Form des Mediums: der Algorithmus“ (S. 170).
Höhen der Narration oder Schlüsselroman?
Abschließend widmet Frieder von Ammon sich einem Phänomen, das so alt ist wie die Literatur selbst ist, seit der Lektüre der „Bibel“ und der „Ilias“ wird es diskutiert: Welche authentischen Ereignisse und Personen liegen welchem literarischen Text zugrunde? In „Das Werther-Paradigma. Goethes ‚Werther‘ und ein Grundproblem modernen Erzählens“ (S. 171–185) greift er aktuelle Beispiele auf. Gleich eingangs konstatiert Frieder von Ammon: „Mit Autoren und Autorinnen persönlich umzugehen, kann gefährlich sein“ (S. 171). Wenn Autoren reale Personen als Vorbilder verwenden, gelten ihnen meist „ästhetische Normen (…) mehr als ethische“ (S. 172). Und er listet Fälle der jüngeren Zeit auf: Karl Ove Knausgård, Max Frisch, Maxim Biller. Jeweils kam es zu Protesten der Vorbilder.
Ausführlich zitiert Frieder von Ammon Briefe Goethes, mit denen der mehrfach seine Position gegenüber Kestner erläutert. Goethe hat offenbar Skrupel, ob er sich seinen Freunden gegenüber fair verhielt. Und er benutzt verschiedene Metaphern, um sich zu rechtfertigen. Eine davon aus dem religiösen Bereich: „genauer: der Bibel“ (S. 178). Wie die „Werther-Figur, die ja bereits im Roman-Titel mit Christus in Verbindung gebracht“ werde, präsentiere sich der Autor in der Rolle Christi: „Der poetologische Kontext dieser Stilisierung ist deutlich: Es ist der zeitgenössische Geniediskurs und mit ihm das Modell einer starken Autorschaft, in dessen Rahmen Goethe argumentiert“ (S. 178). Man könne – so von Ammon – „das Werther-Paradigma auch als eine Epochensignatur auffassen – und den sich selbst und die Menschen in seinem Umfeld für die Narration opfernden Autor als eine Symbolfigur des modernen Erzählens“ (S. 179).
Um 1900 kam es im Zuge dieses Konflikts zu Zuspitzungen, unter anderem in Form eines Gerichtsverfahrens, bei dem der Autor Johannes Valentin Dose angeklagt und verurteilt wurde. Ein Rechtsanwalt hatte sich in der Figur eines Alkoholikers wiedererkannt. Der Titel des Werks: „Der Muttersohn. Roman eines Agrariers“. Thomas Mann musste sich heftiger Vorwürfe wegen der „Buddenbrooks“ und des „Zauberbergs“ erwehren, die nicht vor Gericht landeten. Aber immerhin distanzierte sich „Onkel Friedel“, in Christian Buddenbrook erkannte er sich, und veröffentlichte eine empörte Zeitungs-Annonce. In seinem Aufsatz „Bilse und ich“ wehrte Thomas Mann sich gegen den Vorwurf, einen Schlüsselroman verfasst zu haben.
Thomas Mann sprach allerdings der Literarisierung lebender Vorbilder sogar einen positiven Wert zu. Frieder von Ammon folgert: „Demnach müssten sie geradezu dankbar sein dafür, aus den Niederungen der Wirklichkeit in die Höhen der Narration überführt worden zu sein“ (S. 181). Doch nicht alle literarisch geadelten Menschen sind bereit, diesen Ritterschlag zu begrüßen. So wurde auch Maxim Billers Roman „Esra“ von 2003 vor Gericht verhandelt und verboten. Wahrscheinlich ist die Diskussion über diese Frage auch mit Billers Fall längst nicht abgeschlossen. Abschließend zitiert von Ammon einen Freund Kestners: „il est dangereux d’avoir un auteur pour ami“ (S. 185).
Vor nicht allzu langer Zeit brachte das Grenzlandtheater Aachen Goethes Briefroman auf die Bühne und begeisterte nicht nur Kinder und Jugendliche – in anschließenden Diskussions-Runden bestürmten sie die drei Darsteller mit Fragen zu Spiel und Geschehen und der Möglichkeit, selbst Schauspieler zu werden. Offensichtlich hatten sie den Text recht gut verstanden und sich von ihm fesseln lassen. Natürlich ist der Roman bis heute leicht lesbar – diese Essays bieten aber jenes Surplus, das den Unterschied von Verständnis zu Vergnügen ausmacht. So paradox das klingen mag: Werthers tragische Leiden haben ihm einen Ruhm, ein Nachleben und eine Art Karriere in der Kunst ermöglicht, von der andere, erfolgreiche Helden meist nur träumen können. Diese Tradition und die immense, bis heute und gewiss noch länger fortdauernde Wirkung kompakt nachzuvollziehen, macht den besonderen Reiz dieser Sammlung aus. Aufgefächert wie in einem Kaleidoskop lassen sich hier Aspekte verfolgen, die „Werthers“ Erfolg und Nachruhm ausmachen – traurig, dass Jerusalem davon nichts ahnen konnte. Das Buch ist hübsch gestaltet und mit einer Reihe zeitgenössischer Abbildungen versehen.

Frieder von Ammon / Alexander Košenina (Hrsg.)
250 Jahre „Werther“
Hannover 2024
208 Seiten, mit 7 Abbildungen
ISBN 978-3-98859-039-8
Preis: 18,00 €